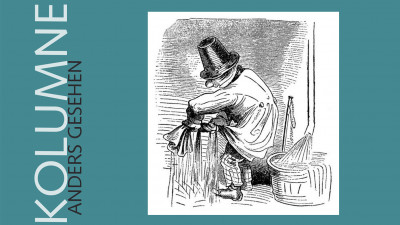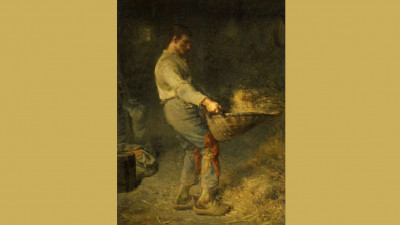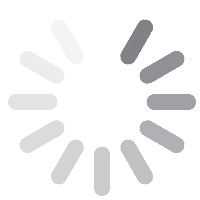Armin Rahn
Prof. Rahn ist ein weltweit tätiger Berater in Fragen der Verbindungstechnologie. Sein neues Buch über ‚Spezielle Reflowprozesse‘ erschien vor Kurzem beim Leuze Verlag. Er ist erreichbar unter [email protected], wohin auch Anfragen über In-Haus Seminare gerichtet werden können.
Kolumne: Anders gesehen – Vom Schummeln
Wenn Kinder nicht nur vor dem Rechner sitzen und Tasten und Knöpfe drücken, dann lernen sie vielleicht beim ‚Mensch-ärgere-Dich-nicht’ Spiel, dass raffiniertes Schummeln zum Spaß gehört – vor allem, wenn die Eltern nicht kleinkariert reagieren. In allen Spielkasinos und jüngst auch bei Doktorarbeiten passt man auf, dass nicht geschummelt wird. Leider bleibt das zumindest bei Politikern – wenn entdeckt – ohne Folgen, obgleich dadurch alle ehrlichen Doktoranden in Misskredit geraten. Schummeln ist aber auch in der elektronischen Fertigung ein mehrschichtiges Problem.
Kolumne: Anders gesehen – Dreck unter den Teppich kehren
Aber wer würde denn schon sowas machen – außer natürlich im übertragenden Sinn? Wobei diese Redewendung wohl kaum auf ihren Ursprung zurückgeführt werden kann, obgleich die Essgewohnheiten des Mittelalters ab und an dafür herbeizitiert werden. In der elektronischen Industrie gibt es natürlich viele Verunreinigungen, aber eher wenige Teppiche. Zwar könnte man den Lötstopplack als solchen bezeichnen, aber Versuche mit gewissen Lacken die Chemikalien, die man als potentiell gefährliche Verunreinigungen sieht, einzukesseln, sind weitgehend erfolglos abgebrochen worden.
Kolumne Anders gesehen – Vom Regen in die Traufe
So sah es Wilhelm Busch in einer berühmten Karikatur, obgleich eine ‚Traufe’ hier nicht dargestellt ist. Aber der Grundgedanke wird effektiv vermittelt, denn wie so oft kehrt sich das Schicksal gegen die Superschlauen. Warum hat die EU trotz vehementer Proteste der Elektronikindustrie eine Richtlinie durchgedrückt, die Blei in den meisten Loten verbot? Obgleich es keinen Hinweis darauf gab, dass es in irgendeiner Weise – speziell in der EU – zu Problemen führte, da sich eine Rückgewinnung bereits gut eingespielt hatte? Das gibt bis heute einen Schwall von Rätseln auf.
Kolumne Anders gesehen: Auf dem Holzweg oder an die falsche Adresse?
Eigentlich war der Holzweg ein Waldweg, auf dem Holz transportiert wurde (in der Fachsprache: Rückeweg) und der meist in schlechtem Zustand wirklich nirgends hinführte. Heute baut man Wege aus Holz, um es den Wanderern einfacher zu machen, über die Baumwipfel zu schauen und digitale Photos zu schießen – ‚Selfies' sind sehr populär. An diese denkt man eventuell, wenn man den journalistischen Rausch der Reportagen liest und sieht, die über die Schulschwänzer der ‚Fridays for Future'-Demonstrationen berichten.
Kolumne Anders gesehen: Widerstand!
Politisch wird Widerstand als die Verweigerung des Gehorsams gegenüber der Obrigkeit beschrieben. Obgleich vorsichtig im Grundgesetz verankert, wird er von vielen Politikern nicht gerne erlebt, denn er rüttelt an ihrer Macht und ihrem Ansehen. Es liegt demnach in der Natur der Sache, wie Widerstand gesehen und beurteilt wird. Wer Widerstand in irgendeiner Form leistet, wird ihn anders sehen und bewerten als jener, der dem Widerstand ausgesetzt ist. Somit ist es meist eine Frage der Macht, wer dabei Gewinner und Verlierer ist. Es ist jedoch nicht unwahrscheinlich, dass beide Seiten am Ende als Verlierer dastehen. Nicht umsonst zeigt die mathematische Spieltheorie, dass Kooperation ‚besser' ist als Konfrontation. Elektrisch sieht die ganze Geschichte völlig anders aus …
Kolumne Anders gesehen: Die Suppe auslöffeln ...
In Vietnam wird die Suppe ‚Pho' mit Stäbchen gegessen. Man fragt sich natürlich, ob man die chinesisch-vietnamesischen Nudeln ‚einbrocken' kann, wie sich das für einen guten Deutschen so gehört, denn die Kunst mit Stäbchen zu essen, ist hierzulande nicht weit verbreitet. In der elektronischen Fertigung geht es weniger um Stäbchen oder dem Auslöffeln als eher ums Ausschöpfen. Dies ist nämlich eines der Probleme beim Pastendrucken in der Produktionslinie für oberflächig bestückte Platinen.
Kolumne: Ex oriente lux [1]
Diese römische Bemerkung zum Sonnenaufgang (‚Das Licht kommt aus dem Osten.') wurde von den frühen Christen vereinnahmt und auf ihren Erlöser umgemünzt. Seiner Popularität wegen unterzog sich diese Redewendung über die Jahrhunderte und -tausende noch einer Reihe anderer Umdeutungen, bis sie endlich sowohl in der Filmindustrie wie auch in der Tourismusbranche als Aufhänger fungieren muss. Jedoch waren und sind nicht nur Religionsgründer, Dichter und Philosophen vom Licht fasziniert – auch Wissenschaftler der verschiedensten Fachkreise beschäftigen sich eindringlich mit diesem Phänomen.
In Kalamitäten geraten
Das ‚französische' Stinktier Pepe Le Pew, seit den 1940er Jahren bekannt als Comicfigur der ‚Looney toons' (Warner Brothers), wird nicht in der Fortsetzung der beliebten Filmreihe ‚Space Jam' vorkommen [1]. Ihm wird vorgeworfen, sich gegenüber weiblichen Cartoon-Charakteren sexuell übergriffig zu verhalten [2]. Pepe ergeht es damit wie so vielen anderen, denen einige wenige mit lauten Protesten ein Fehlverhalten nachsagen. Was früher wohl in der Bierkneipe oder in Damenzirkeln verhallte, zeitigt heute dank der Elektronik eine weitreichende Wirkung.
„die kertz ist vff den nagel gebrant“
Ob nun die Redewendung ‚auf den Nägeln brennen' aus dem mönchischen Bereich stammt oder aber aus der Folterkammer, wird wohl nicht mehr zu klären sein. Auch Sagen und Märchen werden zur Herkunft herangezogen. Unangenehm muss es auf alle Fälle gewesen sein, wenn man zu eifrig bei der Andacht war oder unaufmerksam. Heiß wird es auch im Reflowofen: die Temperaturen müssen über den Schmelzpunkt der Legierung gebracht werden, damit Benetzung und eine Lötstelle entsteht. Andererseits muss man aufpassen, dass es nicht zu warm wird, denn dann leiden Bauteile und Leiterplatten.
Es gilt, die Spreu vom Weizen zu trennen
Nach dem Dreschen mit dem Dreschflegel wartete man auf einen guten Wind, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Die leichteren Hülsen wurden von dem Luftzug weiter weggetragen als die Körner, die nahe auf den Tüchern landeten. Das war eine dreckige und schwere Arbeit, die heute natürlich zumindest in den meisten Gegenden von Maschinen übernommen wird. Immerhin kann man diesen Arbeitsgang, der nach dem großen Krieg noch auf dem Lande üblich war, derzeit in einigen Museumsdörfern den Kindern zeigen. Beim Recycling elektronischer Produkte, die aus ‚unerklärlichen Gründen' ihr Lebensziel erreicht haben, wurden in ärmeren Ländern ähnliche Tätigkeiten übernommen. Tatsächlich versucht man auch diese Arbeit mit Maschinen zu erleichtern.