Das Technologieunternehmen Jenoptik aus Jena setzt eine sächsisch-thüringische Erfolgsgeschichte fort. Derweil kristallisieren sich die Arbeitsplatzeffekte durch die jüngsten Infineon-Investitionen heraus: 7.000 Jobs sollen durch die Fab IV entstehen. Die Subventionen für solche Projekte bleiben aber umstritten, und der starke KI-Einsatz sorgt für Diskussionen. Derweil nimmt die Uni Dresden einen weltweit einmaligen Neuro-Großrechner in Betrieb.
 Blick auf die neue Jenoptik-Fabrik in Dresden
Blick auf die neue Jenoptik-Fabrik in Dresden
„Wir sind stolz, dass wir diese mit knapp 100 Mio. € größte Einzelinvestition der jüngeren Firmengeschichte ‚in time' realisiert haben“, betonte Jenoptik-Chef Stefan Traeger zum Fabrikstart. „In dem herausfordernden Umfeld mit stetig steigenden Preisen und knappen Ressourcen ist dies eine hervorragende Leistung.“ Zugleich sei diese Investition ein Bekenntnis des Unternehmens zum Standort Deutschland und zum Silicon Saxony, das längst weit über Sachsen hinausgewachsen ist. „Das ist eine wirklich gute Sache, dass wir hier ein so starkes Netzwerk haben“, sagte Traeger. Dies sei kein Wunder: „Dresden ist heute zweifellos das Zentrum der Halbleiter-Industrie für ganz Europa.“
Jenoptik gehört zu den Nachfolge-Unternehmen des DDR-Kombinats Carl Zeiss Jena und ist von daher schon seit Jahrzehnten eng mit dem Mikroelektronik-Standort Dresden verbunden. Seit 2007 unterhält das Jenaer Unternehmen eigene Produktionsstätten für Optiken und Sensoren in der sächsischen Landeshauptstadt, die bisher aber über das Stadtgebiet verstreut waren – und insgesamt rund 200 Menschen in Dresden und Jena beschäftigen. Mit der neuen Fab zieht Jenoptik nun seine Dresdner Aktivitäten nach und nach an einem Platz zusammen.
 Ministerpräsident Michael Kretschmer (Mitte) durfte als Erster auf den symbolischen roten Knopf für die neue Jenoptik-Fabrik drücken. Rechts von ihm steht Jenoptik- Chef Stefan Traeger, auf der anderen Seite Jenoptik-Vorstand Ralf Kuschnereit (links) und Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert
Ministerpräsident Michael Kretschmer (Mitte) durfte als Erster auf den symbolischen roten Knopf für die neue Jenoptik-Fabrik drücken. Rechts von ihm steht Jenoptik- Chef Stefan Traeger, auf der anderen Seite Jenoptik-Vorstand Ralf Kuschnereit (links) und Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert
Sechs Arbeitsplätze im Umfeld für jeden Job in der Infineon-Fab erwartet
Derweil hat Infineon nun vom Bundeswirtschaftsministerium die finale Zusage für den Milliardenzuschuss für seine neue, milliardenteure Chipfabrik Nummer 4 in Dresden erhalten. Zuvor hatte bereits die EU grünes Licht für die Beihilfen gegeben. Der Rohbau sei inzwischen nahezu abgeschlossen, der Bau liege im Plan, betonen die Manager. Das Unternehmen hatte bereits vor zwei Jahren mit dem Bau begonnen, weil EU, Bund und Freistaat Sachsen noch vor den finalen Förderbescheiden signalisiert hatte, dass die Subventionen auch tatsächlich fließen werden.
Dafür konkretisierte der bayrische Halbleiterkonzern nun auch die Arbeitsplatzeffekte. Demnach will das Unternehmen in seinem neuen Werk rund 1.000 neue Arbeitsplätze schaffen und geht davon aus, dass dadurch im Umfeld rund 6.000 weitere Jobs bei Zulieferern, Dienstleistern und Versorgern entstehen. Dabei stützt sich Infineon auf die Studie ‚Von Chips zu Chancen - Die Bedeutung und Wirtschaftlichkeit der Mikroelektronikförderung' des Zentralverbands der Elektro- und Digitalindustrie (ZVEI). Die beziffert den Arbeitsmarkteffekt einer modernen Halbleiterfabrik auf sechs Umfeld-Arbeitsplätze auf jeden Job im Werk selbst.
„Um die ehrgeizigen Ziele Europas im Chipsektor zu erreichen und die Wettbewerbsfähigkeit wirklich nachhaltig zu sichern, müssen diese starken Regionen gezielt gestärkt und weitere Technologiezentren aufgebaut werden“
„Die abschließende Bestätigung zur Förderung unserer Smart Power Fab ist ein wichtiger Meilenstein für uns als Unternehmen und ein starkes Signal für das europäische Halbleiterökosystem“, betonte Infineon-Konzernchef Jochen Hanebeck. „Mit den in Dresden gefertigten Halbleitern tragen wir dazu bei, die Wertschöpfungsketten europäischer Schlüsselindustrien künftig noch robuster zu gestalten.“
 ‚Silicon Saxony‘- Geschäftsführer Frank BösenbergRechnet man alles zusammen, steckt Infineon rund fünf Mrd. in den Ausbau des Mikroelektronik-Standortes Dresden. Das meiste davon fließt in den Bau der neuen ‚Smart Power Fab', die Analog-, Hybrid- und Leistungsmikroelektronik für Wärmepumpen, Solaranlagen, Rechenzentren, Elektroautos und andere Technologieprodukte herstellen soll. Den größten Teil dieser Großinvestition finanziert Infineon selbst, ein Fünftel sind Subventionen. Die wiederum kommen von Bund und Land über die Förderprogramme des EU-Chipgesetzes sowie für „Wichtige Projekte von gemeinsamem europäischem Interesse in der Mikroelektronik“ (Ipcei-ME). Zudem investiert das Unternehmen rund 300 Mio. € in die Modernisierung seiner drei Bestandsfabriken in Dresden. „Darüber hinaus investiert Infineon in Dresden auch über seine Beteiligung am Joint Venture, European Semiconductor Manufacturing Company (ESMC)“, heißt es aus der Konzernzentrale.
‚Silicon Saxony‘- Geschäftsführer Frank BösenbergRechnet man alles zusammen, steckt Infineon rund fünf Mrd. in den Ausbau des Mikroelektronik-Standortes Dresden. Das meiste davon fließt in den Bau der neuen ‚Smart Power Fab', die Analog-, Hybrid- und Leistungsmikroelektronik für Wärmepumpen, Solaranlagen, Rechenzentren, Elektroautos und andere Technologieprodukte herstellen soll. Den größten Teil dieser Großinvestition finanziert Infineon selbst, ein Fünftel sind Subventionen. Die wiederum kommen von Bund und Land über die Förderprogramme des EU-Chipgesetzes sowie für „Wichtige Projekte von gemeinsamem europäischem Interesse in der Mikroelektronik“ (Ipcei-ME). Zudem investiert das Unternehmen rund 300 Mio. € in die Modernisierung seiner drei Bestandsfabriken in Dresden. „Darüber hinaus investiert Infineon in Dresden auch über seine Beteiligung am Joint Venture, European Semiconductor Manufacturing Company (ESMC)“, heißt es aus der Konzernzentrale.
Derweil bleiben die hohen Subventionen für die Halbleiterindustrie in Sachsen und ganz Europa umstritten: So hat der ‚Europäische Rechnungshof' in einem Sonderbericht eingeschätzt, dass die EU-Kommission ihr per ‚Chipgesetz' ausgegebenes Ziel, den europäischen Anteil an der weltweiten Chipproduktion bis 2030 auf 20 % zu verdoppeln, deutlich verfehlen wird.
Tatsächlich, so schätzen die Rechnungsprüfer, werde die europäische Mikroelektronik ihren Weltmarktanteil in der Halbleiterproduktion wohl nur von knapp 10 % auf 11,7 % bis zum Ende der Dekade steigern können. Hauptgründe: Das EU-Chipgesetz ist zu vage, die EU investiert dabei zu wenig, während private und staatliche Akteure in Taiwan, den USA, in Japan, China, Südkorea und anderen Staaten ein Vielfaches in den Ausbau ihrer Mikroelektronik stecken. Zudem sind die Energiepreise in Europa zu hoch, der Fachkräftenachschub zu gering.
Aus Sachsen kommt allerdings der Wunsch, sich durch die Rechnungsprüfer nicht entmutigen zu lassen: „Die technologische Souveränität Europas entscheidet sich in einem beispiellos hart umkämpften und extrem kapitalintensiven Markt“, argumentiert ‚Silicon Saxony'-Geschäftsführer Frank Bösenberg in Dresden. „Subventionen für die Halbleiterindustrie sind mit denen anderer Industrien nicht vergleichbar. Mikrochips sind das Rückgrat nahezu aller Zukunftstechnologien von Mobilität über Energie bis hin zu KI. Investitionen in Milliardenhöhe erscheinen hoch, sind aber notwendig, um die Wettbewerbsfähigkeit Europas überhaupt zu sichern.“
„Wir müssen der KI Grenzen setzen“
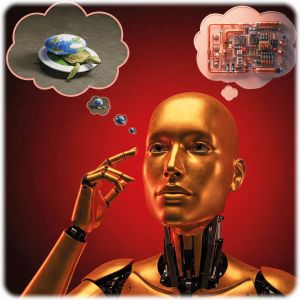 Wenn die Künstliche Intelligenz halluziniert, wird die Erde zur Scheibe und es entstehen seltsame Schaltkreisentwürfe und andere Artefakte, die womöglich funktionieren - ohne dass ein Mensch versteht, warum eigentlichNeu entflammt sind zuletzt aber nicht nur die Debatten um den Sinn staatlicher Chipfabrikzuschüsse, sondern auch Nutzen und Grenzen des KI-Einsatzes. Einerseits mehren sich die Meldungen aus Unternehmen, in denen der betriebswirtschaftliche Nutzen Künstlicher Intelligenz weit unter den Erwartungen blieb, sich zumindest nicht so schnell rechnete. Andererseits fordern Wissenschaftler, auf jeden Fall die Chancen der KI-Technologie unbedingt zu nutzen, den Künstlichen Intelligenzen aber auch Grenzen zu setzen.
Wenn die Künstliche Intelligenz halluziniert, wird die Erde zur Scheibe und es entstehen seltsame Schaltkreisentwürfe und andere Artefakte, die womöglich funktionieren - ohne dass ein Mensch versteht, warum eigentlichNeu entflammt sind zuletzt aber nicht nur die Debatten um den Sinn staatlicher Chipfabrikzuschüsse, sondern auch Nutzen und Grenzen des KI-Einsatzes. Einerseits mehren sich die Meldungen aus Unternehmen, in denen der betriebswirtschaftliche Nutzen Künstlicher Intelligenz weit unter den Erwartungen blieb, sich zumindest nicht so schnell rechnete. Andererseits fordern Wissenschaftler, auf jeden Fall die Chancen der KI-Technologie unbedingt zu nutzen, den Künstlichen Intelligenzen aber auch Grenzen zu setzen.
‚Halluzinationen' und andere schwer oder gar nicht erklärbare Resultate spielen eine wachsende Rolle in Wirtschaft und Gesellschaft, seit immer mehr Unternehmen und Privatleute Künstliche Intelligenz einsetzen, um lästige Routinearbeiten loszuwerden oder Schätze in Datenfluten zu heben. Andererseits ermöglichen die Künstlichen Intelligenzen ganz offensichtlich große Produktivitätsfortschritte. Und wenn wir darauf verzichten wollten, würden Chinesen und Amerikaner auch an den letzten europäischen Bastionen wie Maschinenbau und Automobilindustrie endgültig vorbeiziehen, vom Dienstleistungssektor ganz zu schweigen.
Um dieses Dilemma zu lösen, haben die TU und Fraunhofer vor sechs Jahren in Dresden das ‚Center for Explainable and Efficient AI Technologies' (CEE AI) gegründet. Und in diesem Forscherverbund hat sich immer mehr herauskristallisiert: Viele Künstliche Intelligenzen und ihre ‚Großen Sprachmodelle' und Chatbots sind inzwischen ohnehin so komplex, dass kein Mensch imstande ist, solche Halluzinationen im Nachhinein noch ‚Gedankengang für Gedankengang' nachzuvollziehen. „Schon der Versuch einer Rekonstruktion wäre müßig“, meint Prof. Frank Fitzek als einer der Koordinatoren des ‚CEE AI'. Der Königsweg könnten vielmehr KIs sein, die nach vorgegebenen vertrauenswürdigen Standards arbeiten und sich gegenseitig mit verschiedenen Methoden und auf unterschiedlichen Hardware-Plattformen überprüfen. „Für einige Aufgaben könnten beispielsweise Analogrechner als KI-Basis besser geeignet sein, denn ,analog’ ist von Natur aus genau“, argumentiert der Uni-Professor. Aber jeden Fall aber gelte: „Wir müssen der KI Grenzen setzen, um die Kontrolle zu behalten“, sagt er. „Bestimmte Aufgaben sollten wir einfach niemals an Künstliche Intelligenz übertragen. Ein Beispiel: Wenn wir der KI die Aufgabe und Befugnisse geben, die Erderwärmung sicher zu begrenzen, würden wir vielleicht morgen aufwachen und hätten nur noch 100 Mio. Menschen auf dem Planeten.“
Vorbild Gehirn: TU Dresden startet innovativen Spinncloud-Supercomputer
Die Uni Dresden hat einen weltweit einmaligen neuromorphen Supercomputer in Betrieb genommen: Der ‚Spinncloud' rechnet nach dem Vorbild des menschlichen Gehirns mit künstlichen Neuronen und Synapsen. Er soll ‚Künstliche Intelligenz' (KI) in Europa auf eine neue Stufe heben.
„Inspiriert von biologischen Prinzipien wie Plastizität und dynamischer Rekonfigurierbarkeit, passt sich das System automatisch an komplexe, sich verändernde Umgebungen an“, betont Prof. Christian Mayr von der TU Dresden. „Diese Kombination aus biologisch inspirierter Architektur und technologischer Innovation eröffnet neue Möglichkeiten für KI-Anwendungen in Smart Cities, beim autonomen Fahren und dem taktilen Internet.“
Als ‚Nervenzellen' dienen dem neuartigen Neurorechner sogenannte Spinnaker2-Chips, die der Neuromikroelektronik-Experte Mayr auf Basis von britischen ARM-Prozessoren entwickelt hat. Derzeit sind in dem Superrechner 35.000 Chips verbaut, die in Summe über 5 Mio. Prozessorkerne enthalten – weitere Ausbaustufen sollen folgen.
 Der weltweit einmalige Neuro-Supercomputer ‚Spinncloud‘ ist in Dresden in Betrieb gegangen
Der weltweit einmalige Neuro-Supercomputer ‚Spinncloud‘ ist in Dresden in Betrieb gegangen
Quellen
Jenoptik, Infineon, ZVEI, Silicon Saxony, TUD, Fraunhofer-IAIS


