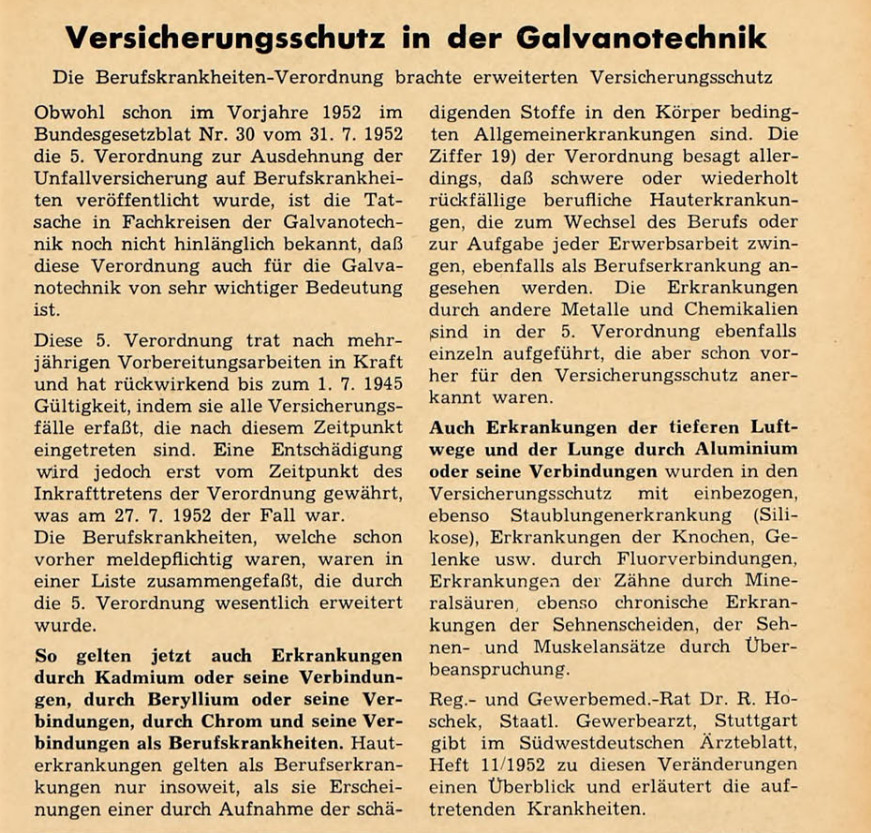Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sind wichtige Themen unserer Zeit. Das war nicht immer so. Vor rund hundert Jahren hatte man einen sicheren Arbeitsplatz, wenn man die Woche überlebte.
Das Fachbuch „Galvanotechnik“ von W. Pfanhauser (1941) beginnt mit den Worten: „Nimm Dir Arbeit vor, als wenn Du noch hundert Jahre zu leben hättest, und arbeite so, als müßtest Du schon morgen sterben.“
Dass das Thema Work-Life-Balance damals noch nicht so in Mode war, erfährt man auf der nachfolgenden Seite: „Es ist mir ein Bedürfnis, meinen Mitarbeitern, die bei ihrer anstrengenden Berufsarbeit während vieler Monate mit dem größten Eifer und Gewissenhaftigkeit ihre Freizeit zu dieser Arbeit verwendet haben, meinen aufrichtigen Dank abzustatten.“
Damit ist gemeint, dass sich die Mitarbeiter nach einem deutlich mehr als acht Stunden währenden Tag abschuften mussten, damit Herr Pfanhauser das Buch fertigstellen konnte.
Die Jahre davor und danach waren nicht besser. Ein guter Indikator für den Wandel der Zeit ist der Urlaub und das damit verbundene Dispositiv. Ab Ende 1945 gab es in den meisten westdeutschen Ländern einen Anspruch auf mindestens 2 Wochen Jahresurlaub, ab 1963 bundesweit sogar drei Wochen für alle Beschäftigten. Eine große Errungenschaft, die mit Pflichten verbunden ist. Urlaub soll Erholung für Körper und Geist sein. Wie dies im Detail auszusehen hat, bekommt man i. d. R. von Lebenspartnern, Verwandten, Freunden oder Nachbarn gesagt.
Doch drei oder mehr Wochen helfen nur wenig, wenn die tägliche Arbeit voller Gefahren steckt. Im o. g. Fachbuch hielt man es noch für nötig, darauf hinzuweisen, Galvaniken nicht in dunklen, schlecht belüfteten Kellerräumen einzurichten. Die Zustände, welche auch noch 15 Jahre später herrschten, lassen sich bei folgenden Fragen und Antworten erahnen, wie sie 1956 in der Zeitschrift „Galvanotechnik“ gestellt wurden.
Gesundheitsschutz
Frage: 1. Besteht eine gesetzliche Verpflichtung, elektrolytische Entfettungsbäder mit einer Absaugung zu versehen?
2. Ich habe längere Zeit vermessingt. Nach 14 Tagen stellte sich bei mir Schlaflosigkeit und Nasenbluten ein. Es handelt sich um ein Messing Ringbad 1800 Ltr. 30—35 °C, 3,5—4 V, 200 A. Bei einer Arbeitskollegin stellte der Arzt Zerrüttung der Nerven fest. Ich behaupte nun, daß diese Erkrankungen auf die starke Gasentwicklung des Messingbades zurückzuführen sind. Habe ich hiermit recht?
Antwort: Frage 1: Es besteht keine gesetzliche Verpflichtung, elektrolytische Entfettungsbäder mit einer Absaugevorrichtung auszustatten. Die beim Betrieb dieser Bäder entstehenden Sprühnebel, welche oft zur Belästigung der Mitarbeiter führen, können in einfacher Weise durch Anwendung netzmittelhaltiger Entfettungsbäder, bei denen sich auf dem Badspiegel ein sahneartiger Schaum bildet, welcher die feinen Sprühnebel zurückhält, beseitigt werden.
Frage 2: Ob die erwähnten Krankheitssymptome auf die angeblich starke Gasentwicklung des Messingbades zurückzuführen sind, kann von Laien nicht mit Sicherheit beurteilt werden. Im übrigen wird auf die Unfallverhütungsvorschrift „Elektrolytische und chemische Oberflächenbehandlung von Metallen“ verwiesen. Zu beziehen vom Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften, Zentralstelle für Unfallverhütung, Bonn.
Quelle: Fachmagazin „Galvanotechnik“ 1/1956
Als der Autor dieser Zeilen seine Ausbildung begann, waren danach bereits ein paar Jahrzehnte ins Land gezogen. In den 1990er Jahren waren Love Parade, Mayday, Raves und das Internet Themen am Arbeitsplatz. Aus Sicht von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz hatte sich einiges getan. Es gab Absaugungen, Sicherheitskleidung, Schutzbrillen und Informationen darüber, wie giftig Cyanide und Nitrosegase sind. Das war in einem Großbetrieb, in vielen kleineren Lohngalvaniken war dies nicht selbstverständlich. Doch auch der große Betrieb konnte manch unsensiblen und fahrlässigen Schnitzer verursachen.
Etwa ein Jahr vor Ausbildungsbeginn ereignete sich ein tödlicher Arbeitsunfall an einer Heißbrünierung. Ein Mitarbeiter kippte auf einen Schlag einen Sack Brüniersalz hinein, die Reaktion darauf folgte umgehend und selbst Jahre später konnte man die Spuren an der fünf Meter hohen Decke beobachten. Das die Todesanzeige zeitgleich mit der Stellenanzeige in der Tageszeitung abgedruckt wurde, kann man als schlechtes Timing abtun. Wirklich viel gelernt hat man aus dem Vorfall nicht. Einmal im Jahr wurde die Brünierung gereinigt. Um dies durchzuführen, gab man den Alkoholikern so lange Schnaps, bis sie bereit waren, die Arbeit auszuüben. Die häufigste Todesursache in der Abteilung war übrigens die Leberzirrhose.
Die fragwürdigen Zustände damaliger Betriebe hatten verschiedene Ursachen. Teilweise geschah dies aufgrund von Unwissenheit bzw. dem Unterschätzen der Gefahren. Das Arbeiten mit Chrom(VI)-Verbindungen ist heute noch in vielen Betrieben normal, ebenfalls mit Cyaniden. Früher kamen zahlreiche, nicht minder gefährliche Chemikalien und Elemente hinzu. Quecksilber, Cadmium, Blei, Chlorkohlenwasserstoffe (Tri, Per, Methylenchlorid) zur Teilereinigung, um nur einige zu nennen. Ein Mitarbeiter einer großen Schleiferei berichtete Mitte der 1990er Jahre von lang anhaltenden Entzugserscheinungen der Kollegen nachdem der Reinigungsprozess zu einer geschlossenen Anlage umgebaut wurde.
Im schlimmsten Fall erreichte man mit einem Prozess in einer Galvanik sogar ein Triple der Sünden:
-
Er war für die Mitarbeiter schädlich.
-
Die erzeugte Schicht war für Kunden und Umwelt schädlich.
-
Die entstandenen Abfallprodukte in der Galvanik wurden nicht oder nur unzureichend entgiftet/entsorgt.
Die Sorglosigkeit früherer Tage lässt sich in der Fachliteratur nachweisen. Dort stellten Leser gerne mal Fragen, für die man heutzutage in größere Rechtfertigungsnot käme. Hier ein Beispiel aus der Galvanotechnik 1/1969, Seite 33:
„Kann Uran elektrolytisch geglänzt werden? Können Sie uns nähere technische Angaben vermitteln?“
Die Antwort darauf fiel erstaunlich nüchtern und kompetent aus, soll aber nicht Gegenstand dieses Artikels sein.
Auch wenn, aus heutiger Sicht, viele Fragen und Antworten sorg- und ahnungslos erscheinen, gab es durchaus Bemühungen, die Situation zu verbessern. Exemplarisch dient ein Auszug aus der GT 11/12-1953 zum Thema Versicherungsschutz:
Rechtliche Situation und Versicherungsschutz sind eine Sache, doch es dauert lange, bis Gefahren und deren Auswirkungen in das Bewusstsein von Mitarbeitern und Vorgesetzten eindringen. Der Autor erinnert sich hier an seine erste Technikerstelle vor ziemlich genau 20 Jahren. Der Inhaber einer kleinen Lohngalvanik versuchte, an allen Ecken und Enden zu sparen, vornehmlich um das gesparte Geld in die eigene Villa und teure Autos zu investieren. Wer neue Gummihandschuhe haben wollte, musste die alten dem Chef vorlegen und dieser entschied, ob die Löcher groß genug waren, um neue Handschuhe zu rechtfertigen.
Eines Tages gab es eine Begehung durch die Berufsgenossenschaft. Diese deckte zahlreiche Mängel, vor allem im Bereich Arbeitssicherheit auf. Der Dialog zwischen BG und Chef lief in etwa so ab:
BG: „Hier fehlen Schutzbrillen.“
Chef: „Kostet Geld.“
BG: „Und hier fehlen Handschuhe.“
Chef: „Kosten ebenfalls Geld.“
BG: „Hier muss ein Feuerlöscher hin.“
Chef: „Zu teuer.“
BG: „Hier fehlt eine Augendusche.“
Chef: „Ist ebenfalls zu teuer.“
BG: „Was ist Ihnen die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter wert?“
Chef: „Keinen Cent!“
Die Aussage sowie die Zustände im Betrieb blieben ohne Konsequenzen. Noch Jahre später prahlte der Chef damit, nichts mehr von der BG gehört zu haben. Gleiches galt auch für nicht durchgeführte Abwasserkontrollen, was den Chef dazu veranlasste, einen Teil seines Zink-Nickel-Abwassers unbehandelt in die Kanalisation zu lassen. Das war 2010, nicht 1910.
Trotz aller Errungenschaften herrschen heute noch in einigen Betrieben traurige Zustände, wenn auch vielleicht auf einem etwas höheren Niveau. Der Autor erinnert sich daran, dass ein CEO einer größeren Lohngalvanik in der Schweiz die vorschriftsmäßige Anschaffung eines Defibrillators mit der Begründung ablehnte, dass seine Mitarbeiter alle „jung, sportlich und gesund“ seien. Den Einwand, dass dies glatt gelogen sei, tat er damit ab, dass man im Notfall zum benachbarten Betrieb 50 Meter weiter gehen könne. Die hätten einen Defibrillator, man müssen nur fragen, ob man ihn ausleihen dürfe.
Das Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und Umweltschutz „nur Geld kosten“, ist auch heute noch tief in den Köpfen verantwortlicher Personen verankert, auch wenn dies schon lange widerlegt wurde. Beim Beispiel des Defibrillators ist man fassungslos, wenn man bedenkt, dass die Firma jährlich Millionen umsetzte, aber nicht bereit war, 3000 CHF zu investieren, um im Notfall das Leben von Mitarbeitern zu retten.
Doch neben den schwarzen Schafen gibt es auch einige tolle Betriebe, die großen Wert auf den Schutz der Mitarbeiter legen. Langfristig zahlt es sich aus. Dies merkt man nicht nur an weniger Krankheitstagen und somit Ausfallzeiten, sondern an der Motivation. Ein sicherer Arbeitsplatz motiviert viel mehr als ein unsicherer, der krank macht. Es motiviert, wenn man weiß, dass einem im Falle eines Falles geholfen und man als Mensch gesehen wird. Vertrauen und Sicherheit schaffen, neben der Motivation, eine Identifikation mit Arbeitsplatz, Firma und den handelnden Personen. Zum Abschluss ein Negativbeispiel aus dem o. g. Betrieb mit der Berufsgenossenschaft:
Ein älterer Mitarbeiter hatte an der Gestellanlage einen Herzinfarkt. Der Chef wurde benachrichtigt und er fuhr den Mitarbeiter umgehend ins Krankenhaus. Er überlebte, musste aber operiert werden. Die Reha zog sich etwas hin. Nach acht Wochen war der Mitarbeiter immer noch krankgeschrieben. Der Chef rastete aus, nachdem er seinen Mitarbeiter im Ort auf dem Fahrrad sah. Seine Meinung: Wer Fahrrad fährt, kann auch arbeiten. Im Betrieb ließ sich der Chef zu folgender Aussage hinreißen: „Wie undankbar kann man sein?! Ich hatte auch mal einen Herzinfarkt, der war viel schlimmer und ich war schon nach zwei Wochen wieder in der Firma. Ich hätte ihn auch an der Anlage verrecken lassen können! Doch ich habe ihn ins Krankenhaus gefahren, habe ihm das Leben gerettet und jetzt fährt er auf meine Kosten fröhlich mit dem Fahrrad spazieren!“
Diese Reaktion kam naturgemäß nicht gut an. Dieser und zahlreiche weitere Vorfälle führten dazu, dass nach und nach alle Mitarbeiter, die bessere Möglichkeiten für sich sahen, den Betrieb verließen. Der Rest machte nur noch Dienst nach Vorschrift. Einige Jahre später brannte mangels Sensoren und Wartungsarbeiten ein Teil der Galvanik ab – der Chef selbst erlitt einen Monat später seinen zweiten Herzinfarkt, an dessen Folgen er verstarb.