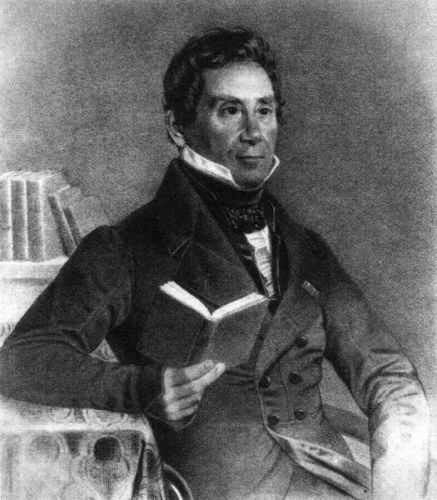Das Zeitalter der Aufklärung und die folgende technische Revolution brachten in Europa viele moderne Bildungseinrichtungen hervor. Eine davon war die Polytechnische Schule in Karlsruhe. Die heißt heute Karlsruher Institut für Technologie (KIT), genießt Weltruhm und wird in diesem Jahr 200 Jahre alt.
Wer glaubt, dass Internationalisierung und Globalisierung Erfindungen der heutigen Zeit sind, täuscht sich. Schon in der Antike sind Handelswege von Fernost zum Mittelmeer, von der Ostsee in die Alpen oder von Russland nach Holland nachzuweisen. Mit diesem Austausch fand gleichzeitig ein Wettbewerb der Qualität der Waren statt. Der verschärfte sich erst recht in den Zeiten der Industriellen Revolution, sodass plötzlich nicht mehr nur handwerkliches Geschick, sondern auch produktionstechnisches Know-how gefragt war. Bildungsangebote wurden zu einem heißen Standortvorteil.
Folgerichtig schrieb der badische Großherzog Ludwig I. zur Eröffnung seiner Polytechnischen Schule, dass man in Baden vor allem dazu fähig sein müsse: „(...) in der Vorzüglichkeit der Erzeugnisse in Form und Stoff mit dem Ausland zu wetteifern.“
In den Jahrzehnten vor der Eröffnung der Karlsruher Schule war philosophisch, technisch und wirtschaftlich viel passiert in Europa. Von Frankreich ausgehend, fegte die Aufklärung Gott vom Thron. Was gestern noch als Wunder galt, konnte man heute wissenschaftlich erklären. Zunächst war es aber der Gedanke der Freiheit des Menschen, des Individuums und der Menschenrechte, der die Aufklärung beflügelte. Die Ideen von Voltaire, Rousseau oder dem Deutschen Kant lieferten den philosophischen Unterbau (was später zur französischen Revolution führte). Descartes schließlich betrieb eine technisch-wissenschaftliche Philosophie und so überwog in der gesellschaftlichen Strömung der Aufklärung schließlich die (Natur-) Wissenschaft. Auf Betreiben vor allem von drei Männern kam es in Paris 1794 zur Gründung der École Polytechnique. Zwei der drei Gründerväter, nämlich Lazare Carnot und Gaspard Monge, waren nicht nur Naturwissenschaftler, sondern vor allem auch als Offiziere und Politiker im Staatsdienst tätig. Beide erkannten den machtpolitischen Nutzen einer umfassenden Bildung. Die École Polytechnique wurde so zur damals fortschrittlichsten technischen Hochschule der Welt ausgebaut.
Kein Wunder also, dass sie vor allem zwei weiteren Hochschulen als Vorbild diente: 1806 eröffnete in Prag ein ähnliches Polytechnikum – und in Karlsruhe 1825 schließlich das heutige KIT. Zu den Gründervätern gehörte der Jurist Karl Friedrich Nebenius, der Ingenieur Johann Gottfried Tulla und der Mathematiker Johann Friedrich Ladomus. Alle drei hatten in Paris studiert und brachten Ideen mit. Da die Gründung einer Polytechnischen Schule in Karlsruhe noch nicht in Sicht war, machte Tulla – wie man heute sagen würde – zuerst ein eigenes Ding, eine Privatschule. Er befürwortete auch die Gründung eines staatlichen Ingenieurscorps, um das Land Baden voranzubringen. Vor allem in den Bereichen Wasser- und Straßenbau. Darüber hinaus gab es das Großherzogliche Physicalische Cabinet.
Was Tulla für den Tiefbau war, das war der Architekt Friedrich Weinbrenner für den Hochbau. Auch er hatte, wie Tulla, mit dem Architektonischen Institut für Bauhandwerker Karlsruhe bereits eine eigene Fachschule gegründet. Beide privaten Bildungseinrichtungen wurden später in das entstehende Polytechnikum eingegliedert. Das hatte 1825 bereits seinen Lehrbetrieb aufgenommen und zwar mit zwölf Lehrkräften. Die mühten sich mit der Vermittlung der Grundlagen. Auf dem Lehrplan standen (natürlich) die Mathematik, Naturwissenschaften, die chemische Technik. Aber auch Fächer wie Nationalökonomie, Zeichnen und darstellende Geometrie.
Wenngleich der Großherzog vom Polytechnikum, siehe oben, „Vorzüglichkeit in Form und Stoff“ gefordert hatte – Geld wollte er dafür nicht ausgeben. Und so war die finanzielle Ausstattung der Schule mehr als mau. Wer in Karlsruhe studieren wollte, der musste Geld mitbringen. Karl Friedrich Nebenius nannte die Einrichtung deshalb in jenen Jahren „eine wahre Missgeburt“. Das Projekt drohte zu scheitern.
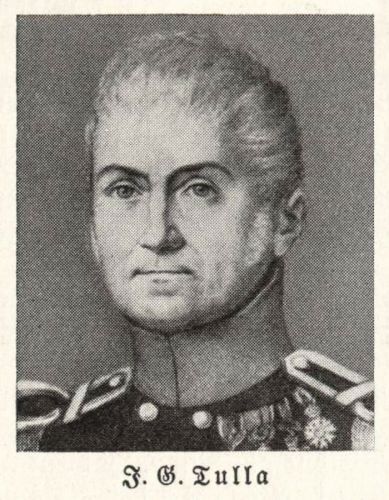 Johann Gottfried Tulla studierte an der École Polytechnique in Paris und gilt als einer der Gründerväter des KIT
Johann Gottfried Tulla studierte an der École Polytechnique in Paris und gilt als einer der Gründerväter des KIT
Das hässliche Entlein mausert sich
Aber dann löste 1830 Leopold den alten Großherzog ab. Leopold gliederte Tullas und Weinbrenners Privatschulen in das Polytechnikum ein und er beauftragte darüber hinaus Nebenius mit der Reform.
Nebenius gliederte das Polytechnikum in fünf Fakultäten um: Wasser- und Straßenbau; Schule für Architekten; Schule für Chemie, Berg- und Hüttenwesen; eine Forstschule; eine Handelsschule. Darüber hinaus modernisierte Nebenius die Lehrinhalte all dieser Fakultäten. 1841 schuf er mit dem Maschinenbau eine sechste Fakultät.
Auch die räumliche Situation war jetzt besser geworden. 1836 konnte man in ein neues Gebäude umziehen, in ein von Heinrich Hübsch gestaltetes Haus, das Platz für 300 Studenten bot. Hübsch war ein Schüler Weinbrenners und orientierte sich in seinem Entwurf an vielen bereits erfolgreich existierenden Schulgebäuden.
War die Polytechnische Schule zu Karlsruhe trotz aller Bemühungen bis dahin eher eine abgelegene Provinzpauke, so änderte sich das schlagartig, als sich die Leitung dazu entschloss, dem Prinzip Alexander von Humboldts zu folgen, der da forderte, Forschung und Lehre müssten zusammen in einer Hand sein. Die verbesserte Finanzsituation machte es möglich, bedeutende Wissenschaftler nach Karlsruhe zu locken.
Es folgte eine regelrechte Blütezeit. 1858 wurde ein internationaler Naturforscher- und Ärztekongress ausgerichtet, der prominent besucht war. Unter anderem kamen Hermann Helmholtz, Justus von Liebig und Rudolf Virchow. Nur zwei Jahre später, 1860, trafen sich auf Einladung des Karlsruher Chemikers Karl Weltzien internationale Größen dieser Wissenschaft und August Kekulé stellte seine neue chemische Nomenklatur vor. Diese bedeutete nichts anderes als den Beginn der modernen Chemie.
Lehrkraft im Karlsruhe jener Zeit war unter anderem der Maschinenbauer Franz Grashof, der die Meinung vertrat, dass alle polytechnischen Schulen den Status von Hochschulen erhalten sollten. Die vorbereitende Ausbildung und die allgemeine Bildung sollten jedoch Schulen und Gewerbeschulen vorbehalten sein. Der neue Großherzog Friedrich I. erhob nach diesem Vorschlag im Jahre 1865 die Polytechnische Schule zur Hochschule. Die Leitung gab sich daraufhin eine Hochschulverfassung samt Selbstverwaltung. Im Jahr 1885 benannte man sich in Technische Hochschule um. Die Fridericiana, wie die Hochschule ab 1902 auch genannt wird, ist somit die älteste Technische Hochschule Deutschlands.
1899 erhielten die Karlsruher das Promotionsrecht. Ab 1901 durften sich, eine Sensation in der damaligen Zeit, auch Frauen zum Studium einschreiben. 1903 war es soweit: Magdalena Neff wurde die erste Frau Deutschlands, die ein ordentliches Studium absolvierte. Und 1915 promovierte man in Karlsruhe mit Irene Rosenberg auch die erste Frau.
Aber es gab auch dunkle Zeiten. Ab 1933 wurde in Karlsruhe die sogenannte deutsche Physik gelehrt, die Einstein nun als nicht existent betrachtete. Die Hochschule in Karlsruhe verspielte in den wenigen Jahren des Nationalsozialismus nahezu ihre gesamte Reputation.
Schon 1945 wurde der Lehrbetrieb mit 120 eingeschriebenen Studenten nach dem 2. Weltkrieg wieder aufgenommen. Ab 1950 ging es wieder aufwärts. Eingeschrieben wurden mehr als 4000 Studenten, darunter 200 Frauen. Und die Digitalisierung hielt Einzug: Der Zuse Z 22 wurde installiert. Dieser Computer ist groß wie ein Einbauschrank, verfügt über 415 Röhren – und er funktioniert noch heute! In diesem Zusammenhang: Die erste E-Mail, die je verschickt wurde, kam 1984 aus Cambrigde, Massachusetts. Und sie landete, nach einem Tag im Äther, natürlich in der Informatik-Fakultät in Karlsruhe. 1967 wurde aus der Hochschule die Universität Karlsruhe.
 Das Gelände des ehemaligen Kernforschungszentrums Karlsruhe im Rheinwald. Nach dem Zusammenschluss zum KIT Campus Nord genannt - (Foto: Wikipedia commons/Rolf Kickuth)
Das Gelände des ehemaligen Kernforschungszentrums Karlsruhe im Rheinwald. Nach dem Zusammenschluss zum KIT Campus Nord genannt - (Foto: Wikipedia commons/Rolf Kickuth)
Aus zwei mach eins
1956 wurde im Karlsruher Norden eine Forschungseinrichtung gebaut, die sich Kernforschungszentrum Karlsruhe (KfK) nannte. Initiator des Zentrums war der damalige deutsche Atomminister Franz Josef Strauß. Forschungszweck war der Einsatz von Kernenergie und die kernphysikalische Grundsatzforschung. Gesellschafter und Geldgeber waren die Bundesrepublik Deutschland (90 Prozent) und das Land Baden-Württemberg (zehn Prozent). Nach dem in Deutschland entwickelten Prinzip des Schwerwasserreaktors wurde zunächst der Forschungsreaktor 2 errichtet. Ihm folgten der nach dem gleichen Prinzip arbeitende größere Mehrzweckforschungsreaktor Karlsruhe sowie der Brutreaktor-Prototyp KNK. Ein besonderer Arbeitsschwerpunkt des KfK lag in der Entwicklung eines modernen Verfahrens für die Wiederaufarbeitung von Kernbrennstoffen, das in der Wiederaufarbeitungsanlage Wackersdorf zum Einsatz kommen sollte.
Seit Anfang der 1970er-Jahre übertrug das Bundesministerium für Forschung und Technologie dem KfK vermehrt neue nicht-nukleare Aufgaben, um den erfolgreichen Ansatz der Großforschung auch auf andere Gebiete, wie zum Beispiel die damals beginnende Umweltforschung, anzuwenden. Mit dem beginnenden Ausstieg aus der Kernenergie in Deutschland verstärkte sich diese Entwicklung durch die Programme Fusionstechnologie, Meteorologie/Klimaforschung, Umwelttechnik, Genetik und Toxikologie, Mikrosystemtechnik und physikalische Grundlagenforschung. An die Stelle der Reaktoren traten neue Großprojekte.
 Prof. Dr. Jan S. Hesthaven ist seit dem 1. Oktober 2024 Präsident des KIT. Er studierte Computational Physics und promovierte an Dänemarks Technischer Universität - (Foto: KIT)1995 wurde der Name geändert von Kernforschungszentrum Karlsruhe in Forschungszentrum Karlsruhe mit dem Untertitel Technik und Umwelt. Dieser Untertitel wurde 2002 durch „in der Helmholtz-Gemeinschaft“ ersetzt.
Prof. Dr. Jan S. Hesthaven ist seit dem 1. Oktober 2024 Präsident des KIT. Er studierte Computational Physics und promovierte an Dänemarks Technischer Universität - (Foto: KIT)1995 wurde der Name geändert von Kernforschungszentrum Karlsruhe in Forschungszentrum Karlsruhe mit dem Untertitel Technik und Umwelt. Dieser Untertitel wurde 2002 durch „in der Helmholtz-Gemeinschaft“ ersetzt.
Am 1. Oktober 2009 schlossen sich das Forschungszentrum Karlsruhe und die Universität Karlsruhe zum Karlsruher Institut für Technologie (KIT) zusammen. Eine Liebesheirat war das nicht. Man war sich vorher zwar nicht spinnefeind, jedoch in herzlicher Konkurrenz zugetan. Die Gründung des KIT erfolgte bereits 2006 mit der Unterzeichnung des Gründungsvertrages. Erste gemeinsame Arbeiten wurden ebenfalls schon ab 2006 durchgeführt, ebenso wird seit 2006 das gemeinsame KIT-Logo auf den Druckerzeugnissen genutzt. 2008 wurde der Gründungsvertrag durch gegenseitige Verpflichtungen bekräftigt und durch einen Festakt zementiert. Seit dem 1. Oktober 2009 ist das KIT offiziell eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Die juristische Eigenständigkeit der Universität und des Forschungszentrums endete mit diesem Datum.
Mit dem KIT ist eine der größten wissenschaftlichen Institutionen der Welt entstanden. Der Name Karlsruher Institut für Technologie ist in Anlehnung an das Massachusetts Institut of Technology (MIT) gewählt worden. Das Gelände des ehemaligen Forschungszentrums nennt sich jetzt Campus Nord und die ehemalige Universität ist der Campus Süd.
Den Lesern der „Galvanotechnik“ begegnen Arbeiten und Forschungsprojekte im Bereich Oberflächentechnik des KIT immer wieder in vielfältigen Erscheinungsformen. Am KIT selbst beschäftigt man sich fakultätsübergreifend mit den verschiedensten Technologien. So finden beispielsweise Oberflächen aus Karlsruhe mit verschiedensten Technologien sowohl in der Architektur, dem Bauwesen, dem Maschinenbau u. v. m. Anwendung. Und auf dem Campus Nord gibt es viele praxisorientierte Schulungen für Sonderbeauftragte in Unternehmen aus den Bereichen Umwelt- und Arbeitsschutz.