Wir alle geben unser Bestes. Es wäre wunderbar, wenn unsere Produkte auch nach Jahrzehnten noch zuverlässig funktionieren würden. Doch im Alltag beobachten wir, dass selbst einfache Geräte im Jahr 2025 oftmals schneller den Geist aufgeben, als man ‚Garantieverlängerung' sagen kann.
Homecomputer der 1980er-Jahre laufen häufig heute noch tadellos – während ein Elektrorasierer von vor nur drei Jahren plötzlich ausfällt. Dieses Phänomen, bekannt als geplante Obsoleszenz, wirft Fragen nach Ethik, Nachhaltigkeit und technischer Machbarkeit auf – insbesondere in der Elektronikindustrie.
Plan oder Zufall?
Geplante Obsoleszenz bezeichnet die absichtliche Gestaltung von Produkten mit einer verkürzten Lebensdauer. Hierbei kommen diverse Methoden zum Einsatz, die sowohl physikalische als auch softwarebasierte Elemente betreffen. Entscheidend ist die bewusste Wahl von Materialien, Bauteilarchitekturen und Konstruktionsprinzipien, die einen verfrühten Verfall induzieren.
Die geplante Obsoleszenz galt zeitweise sogar als ‚Verschwörungstheorie', doch mittlerweile ist sie ziemlich gut belegt [1]. Jedoch wurde nicht jeder Schaden im Vorfeld so geplant und es ist nicht immer leicht, der Industrie Absicht zu unterstellen. Manchmal wird einfach nur geschlampt oder am falschen Ende gespart. Für den Nachweis braucht es mindestens ein klar erkennbares Muster, dessen Resultat aufzeigt, dass der Kunde geschädigt wurde und gleichzeitig der Hersteller profitiert. Das ist nicht immer ganz einfach, weshalb ein noch besserer Weg aus Whistleblowern besteht.
Eine kurze Geschichte des geplanten Verfalls
Einige Fälle von geplanter Obsoleszenz sind mittlerweile sehr bekannt. Etwa bei der Glühbirne, die 1924 noch auf rund 3000 Betriebsstunden kam, 2009 aber lediglich 750 Stunden erreichte [2]. Ähnlich verhält es sich bei nicht austauschbaren Akkus, etwa bei Smartphones und elektrischen Zahnbürsten [3]. Hier ist das Verfallsdatum quasi schon eingebaut. Zahnräder und andere entscheidende mechanische Teile werden aus Kunststoffen statt Metall hergestellt, damit sie nach einer Anzahl vorgegebenen Zyklen bzw. Belastungen zuverlässig versagen.
 Bei vielen Druckerpatronen verhindert eine Chipbestückung das unbegrenzte Refill ihrer Tinte. Sie zählt zu den teuersten Flüssigkeiten der Welt – hinter Skorpion- und Schlangengift, LSD, Pfeilschwanzkrebsblut, Chanel Nr. 5, Insulin und QuecksilberWenn das nicht ausreicht, hilft gelegentlich die Software weiter. Updates sollen Fehler beheben und Systeme optimieren, aber häufig stellen wir das Gegenteil fest. Egal ob Betriebssystem oder Treiber: Das Gefühl, nach dem Update würde es schlechter laufen als vorher, kommt nicht von ungefähr. Beim Betriebssystem mit dem Fenstersymbol sind plötzlich die Hardwareanforderungen gestiegen, die Grafikkarte bringt seit dem letzten Treiberupdate eine geringere Leistung im Lieblingsspiel. Manchmal handelt es sich um Fehler, die mit einem kommenden Patch behoben werden, aber die Häufigkeit lässt nur schwer an Zufall glauben.
Bei vielen Druckerpatronen verhindert eine Chipbestückung das unbegrenzte Refill ihrer Tinte. Sie zählt zu den teuersten Flüssigkeiten der Welt – hinter Skorpion- und Schlangengift, LSD, Pfeilschwanzkrebsblut, Chanel Nr. 5, Insulin und QuecksilberWenn das nicht ausreicht, hilft gelegentlich die Software weiter. Updates sollen Fehler beheben und Systeme optimieren, aber häufig stellen wir das Gegenteil fest. Egal ob Betriebssystem oder Treiber: Das Gefühl, nach dem Update würde es schlechter laufen als vorher, kommt nicht von ungefähr. Beim Betriebssystem mit dem Fenstersymbol sind plötzlich die Hardwareanforderungen gestiegen, die Grafikkarte bringt seit dem letzten Treiberupdate eine geringere Leistung im Lieblingsspiel. Manchmal handelt es sich um Fehler, die mit einem kommenden Patch behoben werden, aber die Häufigkeit lässt nur schwer an Zufall glauben.
Ein aktueller Fall ist Windows 10, welches laut Microsoft die ‚letzte Version' sein sollte [4]. Seit 2021 haben wir Windows 11, der Support für Windows 10 wird am 14. Oktober 2025 eingestellt und Millionen von einwandfrei funktionierenden Desktop-PCs müssen aus Sicherheitsgründen das Betriebssystem wechseln. Doch der Plan ging nur bedingt auf: Wo immer möglich, wechseln zahlreiche Benutzer – allerdings zu Linux.
Es gibt noch viele weitere Beispiele. Apple und Samsung wurden 2018 mit Millionenbußen belegt, weil ihre Betriebssystem-Updates ältere Geräte verlangsamt haben, was Nutzer zum Neukauf drängte [5]. Tintenpatronen sind mit Chips ausgestattet, die das Drucken unmöglich machen, sobald das Füllniveau unter einen bestimmten Grenzwert fällt, obwohl noch Tinte vorhanden ist [6]. Einige Chips können den Druckstopp verordnen, wenn bestimmte Restmengen erreicht werden, insbesondere bei Refill-Druckerpatronen [7]. Manche Hersteller setzen Chips oder Software ein, um die Nutzung nach einer bestimmten Anzahl von Drucken zu blockieren. Firmware-Updates von Druckerherstellern können kompatible Chips oder nachgefüllte Patronen gezielt ausschließen, was die Nutzung blockieren kann [8]. Solche Updates lassen sich nicht immer vermeiden. Harmlos ist der Fall, wenn die Software mit entsprechenden Meldungen nervt. Gelegentlich versorgt sich die Hardware auch selbst, sofern sie im Netzwerk angeschlossen wurde und einen Zugang zum Internet hat.
 Windows 10 bei einer Präsentation 2015 – damals beworben als ‚letzte Windowsversion‘ überhaupt
Windows 10 bei einer Präsentation 2015 – damals beworben als ‚letzte Windowsversion‘ überhaupt
Der Fall Leiterplatten
Bei Leiterplatten werden manchmal gezielt Konstruktionsmerkmale implementiert, die deren Lebensdauer verkürzen. Ein häufig beobachtetes Phänomen ist die Platzierung kritischer Lötstellen in Bereichen, in denen mechanische Beanspruchungen besonders hoch sind. So wird beispielsweise der Netzteilanschluss so integriert, dass bei jedem Einstecken des Stromkabels erhebliche Hebelkräfte auf einige wenige Lötverbindungen wirken. Die Kombination aus einem engen Bauraum, suboptimalen mechanischen Entwürfen und dem Einsatz spröder Lötmaterialien führt zu einer beschleunigten mechanischen Ermüdung dieser Verbindungen. Eine detaillierte Untersuchung solcher Designentscheidungen zeigt, dass durch die bewusste Verkürzung der Lebensdauer von Verbindungen – etwa an den Randbereichen einer Platine – das Risiko eines kompletten Ausfalls bereits nach wenigen Jahren signifikant erhöht wird [9].
 Tin Whiskers (Zinn-Dendriten) in einem GitarrenverstärkerWeitere Beispiele, wenn auch nicht immer geplant, sind folgende:
Tin Whiskers (Zinn-Dendriten) in einem GitarrenverstärkerWeitere Beispiele, wenn auch nicht immer geplant, sind folgende:
- Hersteller setzen schwache Lötmaterialien oder fehleranfällige Lötprozesse ein, um Verbindungen anfällig für Risse oder Überhitzung zu machen (z. B. bei Grafikkarten, Smartphone-PCBs)
- Tin Whiskers, die durch billigen Lötzinn Kurzschlüsse verursachen
- Komponenten werden so auf Leiterplatten platziert, dass Reparaturen unmöglich oder unwirtschaftlich sind
- Integration von Software-Locks, die Geräte nach Hardware-Reparaturen deaktivieren (z. B. der ‚Error 53' von Apple bei Displaytausch) [10]
- Überhitzen kritischer Bauteile durch schlechte Kühlung oder Platzierung nah an Wärmequellen, um Lötstellen zu schwächen (häufig bei Billigherstellern)
- Hersteller wählen bewusst Kondensatoren mit geringerer Temperaturtoleranz (z. B. 85 °C statt 105 °C), um Kosten zu sparen – auf Kosten der Haltbarkeit
Häufig handelt es sich jedoch nicht um Absicht, sondern eine Kombination aus technischen Schwierigkeiten und Kostendruck. Dies zeigt etwa die ‚Annual Outage Analysis 2022' [11]. Rund jedes fünfte Unternehmen hatte in den drei Jahren zuvor einen ernsthaften Ausfall, wobei die Kosten signifikant angestiegen sind. Über 60 % der Ausfälle verursachen Schäden von mindestens 100.000 $, und der Anteil der Ausfälle mit Kosten über 1 Mio. $ ist ebenfalls gestiegen. Trotz hoher Investitionen und verbesserter Technologien gelingt es den Betreibern digitaler Infrastrukturen bislang nicht, die Ausfallraten signifikant zu senken. Um den steigenden Kosten, Risiken und Störungen entgegenzuwirken, wird eine verstärkte Fokussierung auf Schulungen und optimierte betriebliche Prozesse empfohlen.
Nachhaltige Perspektiven und Reflexion
Die Konsequenzen geplanter und ungeplanter Obsoleszenz sind weitreichend. Neben der offensichtlichen wirtschaftlichen Belastung der Verbraucher führt die häufige Erneuerung von Geräten zu einer erheblichen Umweltbelastung. Elektroschrott ist ein globales Problem, dessen Recycling häufig unter prekären Bedingungen erfolgt. Zudem untergräbt diese Praxis das Vertrauen in technische Innovationen und treibt Bestrebungen wie das ‚Right-to-Repair' voran, das auf eine nachhaltigere und reparaturfreundlichere Produktentwicklung abzielt. Erschreckend ist jedoch, wie sehr der Konsument auf den aktuellen Zustand konditioniert wurde – es wird kaum hinterfragt, warum Geräte, die prinzipiell Jahrzehnte halten könnten, nach wenigen Jahren verschrottet werden sollen.
Zukunftsweisende Ansätze in der Produktentwicklung sollten verstärkt auf modulare Bauweisen und langlebige, reparaturfreundliche Designs setzen. Diese Strategien tragen nicht nur dazu bei, die Umweltbelastung zu verringern, sondern sichern auch langfristig das Vertrauen und Interesse der Verbraucher. Parallel dazu wird in der Softwarebranche intensiv darüber diskutiert, wie Supportzyklen verlängert und die Kompatibilität älterer Geräte gewahrt werden kann, ohne dabei die Innovationskraft neuer Technologien einzuschränken.
Angesichts dieser Entwicklungen stellt sich unweigerlich die Frage, ob Gottfried Wilhelm Leibniz diese Situation als „die beste aller möglichen Welten“ bezeichnen würde – oder ob es an der Zeit ist, fundamentale Weichenstellungen in der Technik- und Produktentwicklung vorzunehmen.
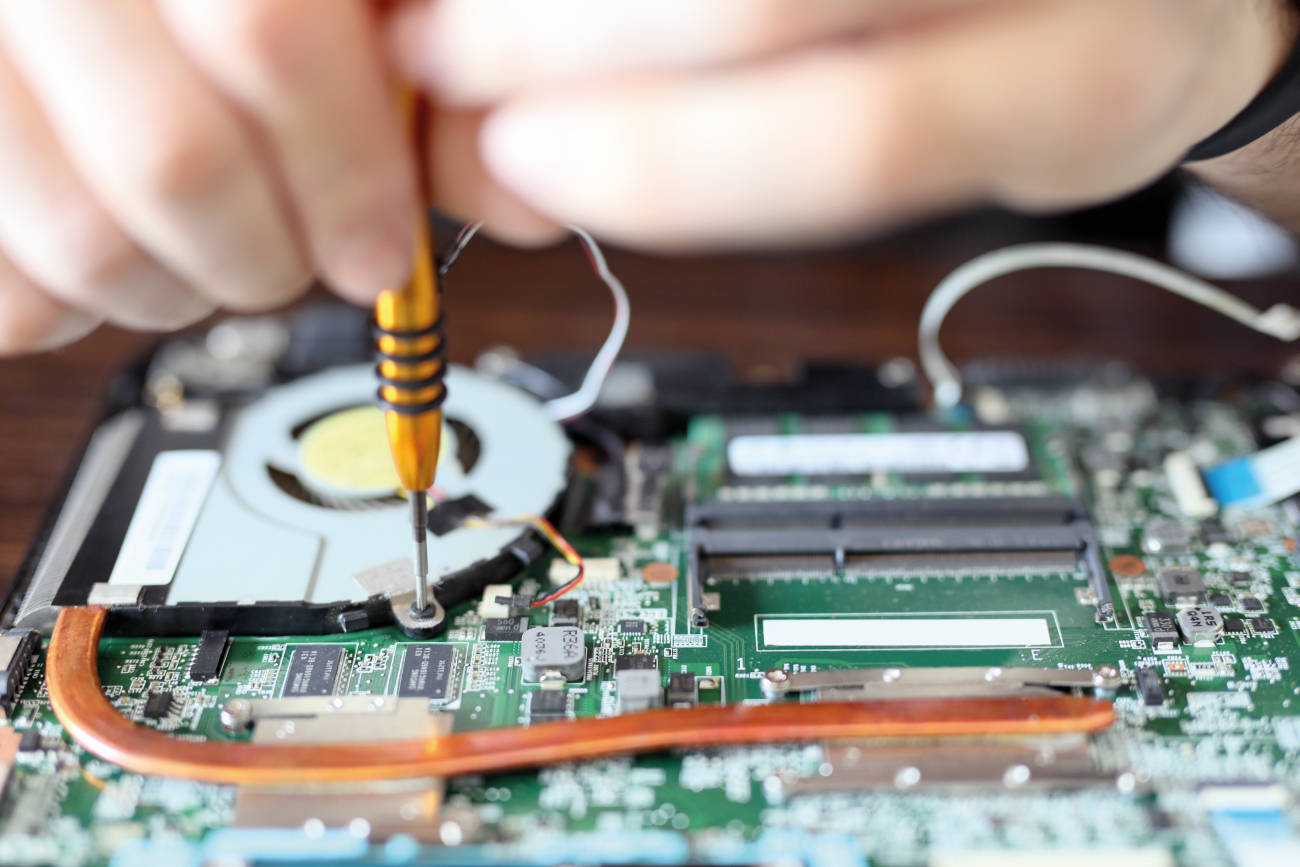 ‚Right to repair‘: Neue EU-Vorschriften sollen Mindestanforderungen an die Reparaturfähigkeit von Smartphones und Tablets verbessern
‚Right to repair‘: Neue EU-Vorschriften sollen Mindestanforderungen an die Reparaturfähigkeit von Smartphones und Tablets verbessern
Quellen
[1] de.wikipedia.org/wiki/Geplante_Obsoleszenz (Abruf: 19.08.2025).
[2] kontrast.at/geplante-obsoleszenz/ (Abruf: 19.08.2025).
[3] www.all-electronics.de/elektronik-entwicklung/die-grosse-uebersicht-zu-obsoleszenz-die-geplante-alterung-unserer-produkte-58-341.html (Abruf: 19.08.2025).
[4] de.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows_10#Neues_Ver%C3% B6ffentlichungs-Modell (Abruf: 19.08.2025).
[5] www.chip.de/news/Millionenstrafe-fuer-Apple-und-Samsung-Handys-werden-durch-Updates-bewusst-langsamer-gemacht_151383829.html (Abruf: 19.08.2025).
[6] cartridgecenter.de/chips-auf-druckerpatronen/ (Abruf: 19.08.2025).
[7] www.toner-druckerpatronen.de/info/toner-chip-druckerpatronen-chip.html (Abruf: 19.08.2025).
[8] www.tonerpreis.de/chips.html (Abruf: 19.08.2025).
[9] www.krekr.nl/content/ubiquitous-planned-obsolescence-in-consumer-electronics/ (Abruf: 19.08.2025).
[10] www.notebookcheck.com/Error-53-Apple-blockiert-iPhones-nach-Fremdreparatur.158972.0.html (Abruf: 19.08.2025).
[11] www.businesswire.com/news/home/20220608005270/de (Abruf: 19.08.2025).





